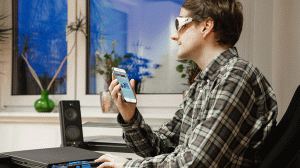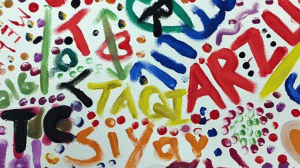ursprünglich erschienen: 30.07.2015
Wir sind hier um Euch Eure Chancen und Möglichkeiten für eine sinnvolle Arbeit im sozialen Sektor zu zeigen. Wir haben Euch schon sehr viel über Sozialunternehmen und Social StartUps erzählt – doch es gibt noch mehr! Die Sozialwirtschaft, inklusive Wohlfahrtsverbänden, sozialen Einrichtungen und andere Träger, bietet Euch viele tolle Möglichkeiten Eure Arbeitskraft sinnvoll einzusetzen.
Deswegen möchten wir Euch in Zukunft über diese Szene up to date halten. Dafür haben wir uns Hendrik Epe ins Boot geholt. Er ist Diplom-Sozialarbeiter. Nach seinem Studium und fünfjähriger Tätigkeit in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung hat er das Arbeitsfeld gewechselt und arbeitet seit nunmehr sieben Jahren im Bereich der Gestaltung und Qualitätssicherung von Hochschulen und Studiengängen im Bereich Gesundheit und Soziales. Also, ein echter Szenenkenner! Auf seinem Blog (www.IdeeQuadrat.de) reflektiert er die Entwicklungen der Sozialwirtschaft und lädt zum mitdiskutieren ein. Unsere Serie zum Thema „Die Zukunft der Arbeit in der Sozialwirtschaft“ macht es möglich. Der Artikel erschien ursprünglich hier.
Wenn irgendwo von einer Chance für etwas gesprochen wird, muss es auf der anderen Seite Probleme geben.
Oder Herausforderungen.
Herausforderungen finde ich im vorliegenden Kontext passender, da diese eher Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen bieten.
Welche Herausforderungen sind mit Blick auf die Zukunft von Organisationen der Sozialwirtschaft erkennbar?
In meinen Augen sind Themen, die als Herausforderungen bezeichnet werden können und somit eine Reaktion notwendig werden lassen vor allem:
- Die demographischen Veränderungen in Deutschland, die für die Sozialwirtschaft Auswirkungen hinsichtlich fehlender Fachkräfte auf der einen und sich verändernden Aufgabenfeldern (von der Jugendhilfe zur Altenhilfe) auf der anderen Seite haben. Bezogen auf den Fachkräftemangel ist einerseits die Frage nach der Besetzung der Stellen als quantitatives Problem zu klären: Gibt es genügend Bewerber für die offenen Stellen? Gleichzeitig stellt sich aber noch ein weiteres Problem, dass sich in dem strapazierten Begriff der Generation Y manifestiert. Hier ist die Frage zu klären, wie Organisationen der Sozialwirtschaft auf sich verändernde Werte sowie Ansprüche der zukünftigen Arbeitnehmer reagieren. Mit anderen Worten stellt die begrenzte Anzahl an zukünftigen Arbeitnehmern auch noch grundsätzlich andere Anforderungen an die Ausgestaltung der jeweiligen Arbeitsplätze.
- Die zunehmenden Tendenzen zur Ökonomisierung der Sozialen Arbeit mit enormen Anforderungen an Wirkungsmessung, zunehmender Konkurrenz der Organisationen untereinander, zunehmender Konkurrenz durch externe Akteure (bspw. Social Entrepreneurship).
- Gleichzeitig steigender Komplexität der durch die Organisationen wahrzunehmenden Aufgaben (Multiproblemklientel).
- Darüber hinaus kommen Anforderungen hinsichtlich sozial und ethisch ebenso wie ökologisch korrekter Handlungen hinzu, die auch für Organisationen der Sozialwirtschaft Auswirkungen haben.
Die obige Aufzählung ist nicht abschließend und kann konkretisiert werden. Deutlich wird jedoch, dass die Anforderungen an Organisationen der Sozialwirtschaft in verschiedenen Richtungen gestiegen sind und weiter steigen werden. Die Komplexität der Aufgaben und Anforderungen erhöht sich weiter.
Darüber hinaus waren Organisationen der Sozialwirtschaft eigentlich schon immer mit komplexen – im Gegensatz zu komplizierten – Herausforderungen konfrontiert.
Die Arbeit mit Menschen – ob als Mitarbeiter oder als Kunden/Klienten – ist aufgrund der Nichtvorhersagbarkeit der Reaktionen immer komplex.
Der Blick jedoch beispielsweise auf viele Studiengänge des Sozialmanagements zeigt, dass versucht wird, mit „alten“, tayloristischen Methoden des Managements auf diese Herausforderungen zu reagieren. Angefangen von Methoden wie dem „Qualitätsmanagement oder -sicherung“ über „Führen mit Zielvereinbarungen“ bis hin zu „Prozesskostenrechnung“ werden Inhalte vermittelt, die zwar dem aktuellen Stand der Wissenschaft bezogen auf Management von Organisationen entsprechen, die jedoch nicht ausreichend zu sein scheinen, um Organisationen „dynamikrobust“ aufzustellen.
Das ist also die eine Seite.
Die andere Seite ist die Frage, wie die oder besser „eine” neue Arbeitswelt aussehen kann.
Diese Frage stelle ich mir schon länger. Eine eindeutige, alles umfassende Antwort kann ich und kann es auch nicht geben.
Guido Bosbach hat sich die gleich Frage gestellt.
Er kommt zu dem Fazit, dass die „neue Art der (Zusammen-)Arbeit (…) kein klares schlüssiges Konzept [ist]. Es gibt keinen Masterplan, keinen Blueprint, kein „so muss man das machen“. Es gibt „nur“ eine Vielzahl Ideen und Impulse die sichtbar werden lassen, dass „anderes arbeiten“ – entgegen der unserer Sozialisierung geschuldeten Wahrnehmungen, dass alles so wie es ist zu bleiben hat – möglich, und vor allem erfolgreich möglich ist.
Kein klares Konzept, das ist richtig. Eine Vielzahl von Ideen und Impulsen? Auch richtig!
Aber vielleicht geht es doch etwas konkreter?
Es geht um die Bewältigung heutiger und zukünftiger Herausforderungen, es geht um Innovationsfähigkeit, um die Schaffung von Lösungen, die sinnvoll und nachhaltig sind.
Aber vor allem geht es um Menschlichkeit. Die Schaffung einer sich am Menschen orientierenden Arbeitswelt.
Eigentlich ein absurder Gedanke.
An was, bitte schön, sollte sich die Arbeitswelt sonst orientieren, wenn nicht am Menschen? Schade, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten diese Orientierung am Menschen einer Orientierung am „höher, schneller, weiter“ gewichen zu sein scheint.
Immer noch zu abstrakt? Richtig!
Somit konkreter:
Als Quintessenz für eine neue Arbeitswelt sehe ich die drei Prämissen von Laloux:
Ich habe schon in einem vorherigen Artikel das Buch gewürdigt, deswegen hier nur kurz:
Die drei Prämissen, die er in Organisationen sieht, die anders und gleichzeitig enorm erfolgreich agieren, sind
- Selbststeuerung,
- Sinn und
- Ganzheitlichkeit.
Selbststeuerung bedeutet, dass alle Mitglieder der Organisation alle Entscheidungen selbst treffen können, sofern sie sich 1. den Rat der von der Entscheidung Betroffenen und 2. den Rat der Experten in der jeweiligen Angelegenheit eingeholt haben. Ein wesentlicher Aspekt ist hier die Transparenz und der Zugang zu Informationen, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden können. Und, ganz klar, ohne Zusammenarbeit und vor allem ein Menschenbild, dass auf gegenseitigem Vertrauen basiert, geht hier nichts.
Sinn bedeutet, dass die Organisationen, in denen die genannten Prinzipien funktionieren, einem klaren Sinn, einen Unternehmenszweck, einem „Warum” folgen, der oder das für alle Mitglieder der Organisation verständlich, einleuchtend und sinngebend ist. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um „Weltverbesserung“ handeln, auch bspw. der Zweck der Schaffung von Arbeitsplätzen in einer benachteiligten Region kann sinnstiftend wirken. Mit klaren, auf den Sinn ausgerichteten, freien Entscheidungen aller Mitarbeiter wären bspw. Zielvereinbarungen hinfällig.
Ganzheitlichkeit bedeutet, dass „der ganze Mensch“ mit all seinen Emotionen, Zweifeln, Gedanken etc. die Organisation mitgestaltet. Nicht mehr der Kampf um Macht, um “meine“ Meinung, das Wahren meines Gesichts steht im Fokus. Das ist nicht notwendig. Eine Kultur der Offenheit und Akzeptanz entsteht.
Und wenn jetzt die obigen Herausforderungen kombiniert werden mit den Prämissen von Laloux ergibt sich folgende These:
Eine neue, auf den Menschen basierende Arbeitswelt bietet Chancen ungeahnten Ausmaßes für die Sozialwirtschaft.
Konkret, gegliedert nach den Herausforderungen:
1. Herausforderung: Fachkräftemangel
Wenn es Organisationen der Sozialwirtschaft gelingt, ihren ureigenen Sinn, ihr eigenes “warum” herauszuarbeiten und dieses dann auch noch nach innen und nach außen in transparenter, authentischer Art und Weise zu vermitteln, dürfte der Fachkräftemangel eigentlich kein Thema mehr sein. Wenn ich weiß, warum ich arbeite und dies auch noch mit meinen eigenen, inneren Werten vereinbaren kann, dann arbeite ich gerne und motiviert.
Aber was wollen die Mitarbeiter eigentlich? Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Hier hilft ein Blick in die Wissenschaft:
Die Erhebungen von Otto et al. (2015) sind da ganz spannend. Sie kommen – bezogen auf Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen – zu dem Schluss, dass “sich durchaus einige Unterschiede zwischen den Generationen [ergeben], die Mehrzahl der Kriterien für einen attraktiven Arbeitgeber hat jedoch für Mitarbeitende jeden Alters eine ähnliche Relevanz.“
Egal wie alt, Mitarbeiter wollen also alle eigentlich das Gleiche. In Organisationen der Sozialwirtschaft wird das nicht wesentlich anders sein, vermutlich.
Und welche Kriterien sind das?
Ohne die Studie komplett zu zitieren, hier die Kriterien, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen, absteigend nach Bedeutung für die Generationen, gelistet:
- Gute Lage des Standortes
- Flexible Arbeitszeiten
- Gute Produkte und Leistungen des Unternehmens
- Positive finanzielle Situation des Unternehmens
- Ruf des Unternehmens als guter Arbeitgeber
- Akzeptable Arbeitsbelastung
- Entscheidungsfreiheit bei der Arbeit
- Herausfordernde Tätigkeiten
- Innovatives Unternehmen
- Klare Vision der Unternehmensleitung für langfristigen Erfolg
- Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Hoher Arbeitslohn
- Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten
Zusammenfassend sind die Kriterien, die einen Arbeitgeber attraktiv machen – bis auf wenige Kriterien – „weiche“ Kriterien.
Dinge wie „gute Leistungen“, flexible Arbeitszeiten, der Ruf des Unternehmens als guter Arbeitgeber, die Entscheidungsfreiheit bei der Arbeit oder Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten sind gestaltbar und veränderbar.
Es geht zu großen Teilen darum, was getan wird und warum getan wird, was getan wird. Es geht zu großen Teilen um den Sinn der eigenen Arbeit, um die Werte, um die Möglichkeit, eigene Dinge voranzutreiben, selbstbestimmt mit anderen zusammen etwas größeres zu schaffen, Wert zu stiften, wie auch immer.
Wie gesagt: Es muss klar sein, warum die Organisation tut, was sie tut.
2. Zweites Problem: die zunehmende Ökonomisierung
Jetzt wird es wohl ein wenig kompliziert:
Wie kann, bei begrenzten finanziellen Mitteln, die auch noch durch Kostenträger vergeben, also zu weit überwiegenden Teilen nicht selbst erwirtschaftet werden, (negativen) Ökonomisierungstendenzen begegnet werden?
Diese Frage ist sicherlich einer vertieften Untersuchung wert. Mit Blick aber auf die oben angeführten Aspekte einer “neuen Arbeitswelt” ergeben sich für mich Möglichkeiten, allerdings bislang nur aus einer sozusagen theoretischen Perspektive:
Wenn den Mitarbeitenden in den Organisationen der Sozialwirtschaft klar ist, warum sie tun, was sie tun und wenn gleichzeitig alle Entscheidungen, die innerhalb der Organisation unter Zugrundelegung dieses Zwecks der Organisation getroffen werden, können sich völlig neue Möglichkeiten ergeben:
So werden keine Entscheidungen aus einzig ökonomischen Gesichtspunkten mehr getroffen.
Bspw. werden Jugendliche nicht mehr in stationären Einrichtungen gehalten, obwohl allen Beteiligten klar ist, dass die Maßnahme keinen Sinn mehr macht. Stationäre Altenhilfeeinrichtungen, die einen wirklichen Zweck verfolgen, werden automatisch darauf achten, dass die Qualität in den Einrichtungen stimmt. Sonst passt die Realität nicht mit dem Zweck der Organisation überein. In einem Arbeitsmarkt, der bspw. in der Pflege zu einem eindeutigen Nachfragermarkt geworden ist, ein Todesurteil für die Einrichtung.
Gleichzeitig wissen die Kostenträger, mit wem sie es zu tun haben, auf was sie sich einstellen können und wo auch die Grenzen des Möglichen sind. Ich gehe davon aus, dass eher Geld gespart als “sinnlos” ausgegeben wird.
Es ist anzunehmen, dass dies anfänglich schmerzhaft sein kann. Vielleicht…
Vielleicht kann es sein, dass einige Organisationen “vom Markt” verschwinden, da deren Zweck nicht eindeutig genug dargelegt ist oder es vielleicht auch zu viele Organisationen mit einem gleichen Zweck gibt, die Nachfrage jedoch teilweise zu gering sein kann.
Schon wieder Wettbewerb?
Ja, warum nicht? Warum sollen Organisationen bestehen bleiben, die nicht wirklich sinnvoll sind? Um Gelder zu verbrauchen? Das kann es eigentlich nicht sein.
3. Dritte Herausforderung: steigende Komplexität
Naja, eigentlich muss man dazu nicht viel sagen. So ist einer der Hauptanliegen für eine neue Arbeitswelt der Umgang mit steigender Komplexität.
Denn: nicht nur in Organisationen der Sozialwirtschaft, sondern vielmehr in beinahe allen Bereichen der Gesellschaft ist feststellbar, dass die Komplexität zugenommen hat und kein Ende in Sicht ist.
Beispiele gefällig?
Klimawandel, Finanzkrise, Flüchtlingsproblematik, Globalisierung, um nur ein paar zu nennen.
Wer eine Lösung für eins der oben genannten Themen hat, ist wahrscheinlich Gott, wenn ich den hier mal anführen darf.
Es gibt nämlich nicht “eine” Lösung. Es gibt Möglichkeiten, zu reagieren, vielleicht auch zu agieren. Aber klare, einfache Lösungen, einfache Antworten? Wohl eher nicht. Ob eine Reaktionsmöglichkeiten ein gewünschtes Ergebnis liefert, ist zu hoffen, allerhöchstens noch anzunehmen. Sicher zu sagen ist es jedoch nicht.
In Organisationen wird aber (oft) immer noch so getan, als ob einer eine Lösung parat haben muss. Eine eindeutige Antwort!
Wer das ist? Klar, der Chef, wer sonst? Woher aber soll der Chef eine Lösung haben? Warum soll die Lösung des Chefs, der eigentlich gar keine operativen Aufgaben mehr wahrnimmt oder wahrnehmen kann, besser sein, als die Lösungen der Menschen, die sich mit den Problemen wirklich auskennen?
Das gleiche gilt auch für Organisationen der Sozialwirtschaft:
Lösungen und Antworten, die der Sozialarbeiter auf Basis seiner professionellen Ausbildung in Kombination mit der Beziehung zu den Klienten und einer Kenntnis des Feldes, in dem die Organisation tätig ist und natürlich in Abstimmung mit seinem Team findet, kann kaum schlechter sein, als eine Anweisung, Vorgabe oder Regelung des Chefs, oder?
Hier also Selbstbestimmung. In Abstimmung mit den Menschen, die sich wirklich auskennen.
4. Das ethisch einwandfreie Handeln.
Eine Diskussion über den vierten Punkt – das ethisch einwandfreie Handeln – erübrigt sich dadurch, dass Entscheidungen immer in Verbindung zum Zweck der Organisation, zu deren Sinn, stehen.
Als Beispiel: wenn eine Organisation als Zweck die Selbständigkeit von alten Menschen hat, dann werden bspw. die Verabreichung von Psychopharmaka, um die Menschen “ruhig zu stellen” oder Maßnahmen wie die Fixierung dieser Menschen einfach nicht mehr vorkommen (können). Es müssen neue, andere, bessere Lösungen gefunden werden, damit dem Zweck entsprochen werden kann.
Zusammenfassend eine Utopie, oder?
Aber noch einmal Guido Bosbach:
Warum muss alles so bleiben, wie es ist?
Ich freue mich auf die Zukunft!
Den ersten Artikel der Serie findest Du hier: Die Generation Y und die soziale Arbeit.